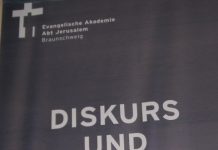„Natur ohne Lobby? Verantwortung für die Schöpfung!
Die Abt Jerusalem Akademie veranstaltet am 18. und 19. Februar 2011 im Franziuskussaal neben der Brüdernkirche die Tagung
"Natur ohne Lobby?" Verantwortung für die Schöpfung! Agrarethik II.
Damit wird die Veranstaltungsreihe nach den Diskursen zur "Grünen Gentechnik" zu dem Wertedilemma "moderner Landwirtschaft" fortgesetzt.
Marc D. in W. und weitere Termine
11. Februar: Marc D. im Sauna-Klub, Wolfsburg
11. Februar: The Band Without Glantz & emmapeel im Nexus
11. und 12. Februar: Valerie Montag in der KaufBar
12. Februar: Ludger und Kippen im Nexus (und weitere Nexus-Termine)
17. Februar: Axel Klingenberg im Guten-Morgen-Buchladen
17., 18. und 19. Februar: blackhole-factory in der Kunstmühle
18. Februar: Poetry-Slam im LOT-Theater
18. und 19. Februar: „Hunger“ in der KaufBar
19. Februar: Jetzt und Hier im LOT-Theater
24., 25. und 26. Februar: „my personal utopia“ in der Kunstmühle
27. Februar: „Händchen klein“ im Figurentheater Fadenschein
27. Februar: „Vom Fischer und seiner Frau“ im Gemeinschaftshaus Weststadt
12. März: Glam-Rock-Party in der RockBar, Wolfsburg
18. März: Bumsdorfer Auslese in der KaufBar
2. April: Jembker-Hof-Revival-Party im CCC, Wolfsburg
9. April: Silver Club (Details folgen)
15. April: The Punchliner Show in der Brunsviga
30. April: 8. Indie-Ü30-Party im Nexus.
Herzlich willkommen!
Eine wundervolle blau-gelbe Zukunft?
Vernissage – Handelsweg 5-7
Etwas abseits des fast-food-Konsums mit 1 A-Lagen und den immer gleichen Modeketten sowie dem angeblichen "shopping in elegance", liegt der Handelsweg. Kunst auf 29 qm bieten dort vier engagierte Männer und eine Frau an. Sie eröffneten die Galerie am 1. Oktober 2010 im Herzen der Stadt. Am Freitag eröffnete die Ausstellung von Alexandra Funke und Sabine Kühn.
STILLE Fotografie in der Torhaus-Galerie
"Früher brachte der Lärm die Menschen aus der Ruhe, heute ist es die Stille". (Ernst Ferstl)
Christa Zeißig
Die BBK Torhaus-Galerie präsentiert im März die Gruppenausstellung STILLE Fotografie.
Ausstellung mit Arbeiten von Christa Zeißig - Yvonne Salzmann - Klaus G. Kohn - Jonas Karnagel - Birte Hennig - Andreas Greiner-Napp- Michael Ewen - Gerd Druwe
11. März - 17. April 2011
Konsumverein – Daumenkinomatografie
Volker Gerling, Daumenkinomatografie: 10. Februar, 20.00 Uhr - Ein Abend magischer Portraits
Verehrtes Publikum, zum Berlinalebeginn gibt es im Allgemeinen Konsumverein
Daumenkinomatografie - es verspricht ein außergewöhnlicher Abend zu werden.
Der Abend findet für Sie kostenfrei statt (Spenden sind natürlich
willkommen). Wir werden für unsere Mitglieder, sofern sie sich anmelden,
gerne Plätze reservieren. Auch für auswärtige Gäste, die sich schon
angekündigt haben, werden wir einige Plätze freihalten.
Allen anderen möchten wir empfehlen frühzeitig zu kommen - "das Handtuch
abzulegen" und in der Bar noch ein Getränk zu nehmen.
Freuen Sie sich mit uns auf einen ganz besonderen Abend!
Herzliche Grüße
Anne Mueller von der Haegen
Einführung der Oberschule
Auch in Braunschweig findet die Diskussion zur neuen Oberschule statt. Die Stadt hat sich entschieden zunächst mal abzuwarten, um zu sehen, welche Anweisungen aus Hannover aus dem Kultusministerium kommen werden.
Eindeutig ist zunächst, dass die sog. neue Oberschule nicht eingeführt wird, weil da ein gutes pädagogisches Konzept oder eine fortschrittliche Schulpolitik dahinter stehen, sondern weil die Hauptschule von den Eltern abgewählt wurde und die Eltern ihre Kinder dort nicht mehr hinschicken. Damit ist das über viel Jahrzehnte von der CDU und FDP geförderte Prinzip der Dreigliedrigkeit (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) gescheitert, und damit auch abertausende Kinder in der Vergangenheit. Nun soll die Oberschule retten, was zu retten ist - hauptsache das Gymnasium bleibt erhalten und es entstehen keine neuen Gesamtschulen. Das heiß, die schulpolitischen Versager von CDU und FDP wollen nun der Bevölkerung deutlich machen, dass die Oberschule das einzig Sinnvolle ist.
Wenn Sie weiterlesen finden Sie die Info „publik“ von Bernd Siegel zum Thema Einführung der Oberschule (Red.).
Vernissage: Gänseblümchendilemma
Inoffizielle Kultur atmet nicht nur in dieser Stadt dünne Luft und so ist es zu begrüßen, dass sich in dieser Hinsicht seit ein paar Jahren wieder etwas mehr tut.
Seit Oktober 2010 gibt es eine neue Projektgalerie in der Braunschweiger Innenstadt. Gegenüber des Cafés „Riptide“, das schon längst die Szene bereichert, mieteten sich „fünf Freunde“ ihren 29 Quadratmeter großen „einRaum“, den sie für Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen.