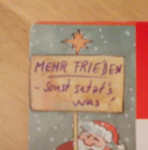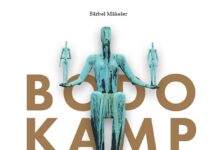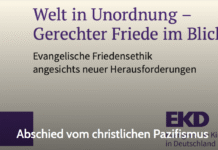Gewalt oder gar Mord als Mittel politischer Durchsetzung finden viele Rechtsextreme auch heutzutage erstrebenswert. Da sie dank ihrer politischen Ideologie weder an demokratische Werte und Institutionen noch an Menschenrechte glauben, sondern an das Recht des Stärkeren und Autoritarismus, ist das argumentativ auch kein Problem innerhalb der Szene.
In rechtsextremen bis rechtsterroristischen Gruppierungen werden auch „Feindeslisten“ oder „Todeslisten“ erstellt. In der Regel finden sich darauf Menschen, die die Ausbreitung rechtsextremer Ideologie verhindern (wollen) – Zivilgesellschaft, PolitikerInnen, JournalistInnen, WissenschaftlerInnen, Kulturschaffende – oder Menschen, die aus Rassismus, Antisemitismus oder Islamfeindlichkeit zu „Volksfeinden“ erklärt werden. Manche Listen dienen der Übersicht, welche Menschen an „Tag X“, also dem Tag der Machtübernahme oder des Putsches durch rechtsextreme Kreise – beseitigt werden sollen, manche sind als Inspiration für konkrete Anschläge gedacht.
Wenn diese Gruppierungen Grüppchen wären, und wenn man sich bedingungslos auf unsere Sicherheitsorgane verlassen könnte, wäre das nicht weiter beunruhigend. So ist die Situation leider nicht. Reiche Geldgeber der Extremisten stehen im Hintergrund zur Finanzierung, in Sicherheitsbehörden befinden sich Rechtsextremisten nicht als Einzelfälle. Nach dem Mord in Hessen, von einem mutmasslichen Rechtsterroristen begangen, soll es einen fahndungspolitischen Paradigmenwechsel geben. Erhebliche Zweife sind angebracht. Im Gegenteil, im rechtsextremen Untergrund scheint man sich auf einen Bürgerkrieg vorzubereiten. Lesen Sie hier: „Was die Höcke -AfD mit der Hannibal-Affäre und dem Mord an Walter Lübcke zu tun hat.“