
Von Edgar Vögel (Teil eins lässt sich hier nachlesen)
Drittens: Das Finanzproblem
Die Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen ist völlig unklar. Einzige Einnahmequelle der Stadt ist der Verkauf der Straßen und Grünanlagen als Baugrund. Der Neubau der Straßen und der Infrastruktur, auch für ÖPNV, die Planungskosten, die Kosten für Ersatzpflan-zungen von Bäumen, für Versickerung usw. sind zu finanzieren. Was die finanzielle Leistungsfähigkeit bzw. -bereitschaft der Partner Wertgrund und DB angeht, sind zumindest bei der DB Zweifel angebracht. Bei der Stadt wissen wir es etwas genauer: mehr als eine halbe Milliarde Defizit bereits jetzt im Doppelhaushalt.
Dafür schlägt jetzt die Stunde der Investoren, Projektentwickler, Makler, Kreditgeber und aller möglichen Finanzinstitute und einiger großer Baufirmen, die solche Größenordnungen bewältigen können. Natürlich wäre es weit hergeholt anzunehmen, die BraWo-Parker würden diese Einladungen ausschlagen und sich mit dem zufrieden geben, was sie nebenan schon haben. Oder doch von der City of Lions zur Brawo-City? Schon die alten Römer fragten gelegentlich: „cui bono“? Tun wir es ihnen doch mal gleich. ….

Viertens: Das Problem mit Starkregen und der Schwammstadt-Konzeption
Der Bereich zwischen Kurt-Schumacher-Str. und Bahnhofsvorplatz im „Gleisdreieck“ ist bei Starkregen überflutungsgefährdet (>50cm), besondere Maßnahmen für Tiefgaragen, Keller und Hauseingänge sind erforderlich. „Aus der vereinfachten Risikoanalyse geht hervor, dass der überwiegende Anteil der im Bahnhofsquartier geplanten Neubauten sowie die „am Hang“ gelegene, geplante Neubebauung auf der Westseite der Kurt-Schumacher-Straße eine hohe, teilweise eine sehr hohe Starkregengefährdung aufweisen“ (Starkregen-Gutachten, S. 10). Lösungsvorschläge gibt es von Planerseite dafür bislang keine. Zudem ist die Versickerung von Regenwasser nur in einem Teilbereich des Plangebietes (mit sandigem Untergrund) ohne weiteres möglich; in anderen mit tonigem Untergrund gar nicht und in weiteren nur mit Problemen.
Fünftens: Das Verkehrs- und Lärmproblem
Sämtliche vierspurige Straßen im Planbereich werden entfernt und zumeist in verringertem Umfang neu gebaut – über 10-15 Jahre hinweg. Über diesen Zeitraum wird das Bahnhofsumfeld ein einziger großer Baustellenbereich sein. Auch danach wird die geplante Verkehrsführung besonders am Knoten: Ring – Ottmerstr./Schillstr. in der Folge absehbar zu häufigenRückstaus führen, das sei alternativlos, so die Gutachter. Längere Wartezeiten bei der Passage parallel zum Bahnhof am Terminal für Fußgänger und Radfahrende werden ebenso prognostiziert.
Der Verkehrslärm zweispuriger Straßen in engen hohen Häuserschluchten liegt deutlich über den Grenzwerten. Die Gutachter stellen fest:
„Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung bestätigten die weiterhin hohen Lärmbelastungen für alle Baufelder. In einigen Bereichen wird auch die Schwelle der Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) am Tag bzw. von 60 dB(A) in der Nacht überschritten (S.12). Der anstehende Lärmkonflikt erfordert die Erarbeitung und Abwägung eines Schallschutzkonzepts im Rahmen des nachgelagerten Bebauungsplanverfahrens.“

Rückbau der Straßen verringert Lärm nicht
Der versprochene „Rückbau überdimensionierter Verkehrsflächen“ hat offensichtlich keineswegs zur Folge, dass die Lärmbelastung in weiten Teilen des Planungsgebiets abnimmt. Wenn z.B. zwischen dem Bahnhof und der Seite mit Hotel und Volksbank auf dem dann ehemaligen Grünstreifen 5- bis 7-geschossige Gebäude platziert werden sollen und der MIV zweispurig direkt vor der Haustür verläuft, müssen „Lärmkonflikte“ entstehen. So genannt im einschlägigen Gutachten. Hier soll also gewohnt und gearbeitet werden?! Wie die sich ab-zeichnende extreme gesundheitsgefährdende Belastung verringert werden soll, verraten die Planer nicht. Man kann darüber spekulieren, dass die versprochenen 30% Sozialwohnungen irgendwo hier liegen werden und nicht an Viewegs Garten.
Sechstens: Das Problem mit dem Bürobedarf
Ein zentraler Begründungsstrang ist die Schaffung von 600 neuen Wohnungen (ein Drittel Sozialwohnungen, 10 % „im mittleren Preissegment“; der Rest im ……). Die meisten hohen Gebäude sollen entweder ganz oder zumindest teilweise aus Büroräumen bestehen undzum Bahnhof blicken. Die jeweiligen Seiten mit Blick auf Viewegs Garten sollen dagegen ganz überwiegend Wohnungen sein. Während die Wohnungen mit wachsender Bevölkerung begründet werden, fehlen zum hohen Anteil an Büroflächen, die ca. die Hälfte aller Bauge-schosse ausmachen sollen, Begründungen für Umfang und Bedarf. Man habe die Büroflächen nach Corona und dem steigenden Homeoffice-Anteil reduziert, ließ eine Planerin wissen. Möchte man mit den vielen Büros und ihren kurzen Wegen Bahnhof-Büro-Bahnhof Fachkräfte aus der Region anlocken, wie der Stadtbaurat unlängst verlauten ließ? Büros, die ob ihrer verkehrsgünstigen Lage erst einmal bezahlt werden wollen. Von wem?
Fazit
Wie schon aus den zahlreichen Gutachten hervorgeht, erzeugen die Planungen in vielen Bereichen eine Fülle von Problemen, für die es bislang keine Lösungen gibt, ja aufgrund falscher Grundannahmen und Voraussetzungen wohl auch nicht geben kann. Sie gefährden das Lokalklima in unverantwortlicher Weise, setzen gesundheitsschädigenden Lärm als Dauerzustand und missachten zudem mehrfach wissenschaftliche Erkenntnisse. Sie werden dem eigenen Anspruch, nachhaltig und zukunftsfähig zu sein, nicht gerecht. Sie sind, zumindest in Teilen, auch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Immobilienbranche, für die Stadt aber wohl eher ein von übermäßigem Geltungsbedürfnis getriebenes Schuldenprogramm.
Der größte Sündenfall aber ist die Bebauung der Ecken von Viewegs Garten, für die es keinerlei Rechtfertigung im Interesse der in Braunschweig lebenden Menschen gibt.
Überlebensnotwendig und das Mittel der Wahl, die Klimafolgen zu begrenzen, ist eine durchgehende grüne Achse vom Bürgerpark bis Viewegs Garten – mit sehr vielen Bäumen und ganz ohne Beton
Foto Nr. 2 (Überflutung, Symbolfoto): pixabay / Foto Nr. 3 (ai-erzeugt): pixabay






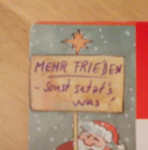


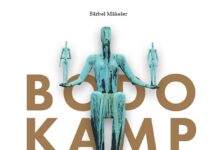





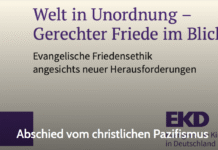










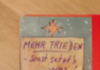

Sehr geehrter Herr Vögel,
vielen Dank füfr Ihre gründlichen Recherchen, die Erschreckendes zutage gefördert haben. Was kann man denn ganz konkret gegen die Umsetzung der Pläne noch tun? Lässt sich da noch was verhindern?
Regine Nahrwold
Hallo Frau Nahrwold,
ich teile Ihr Erschrecken. Sie sprechen mit Ihrer Frage das zentrale Problem an.
„Der Klimawandel führt auch in Braunschweig zu deutlich mehr Tagen mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen als in früheren Jahrzehnten – das ist statistisch bewiesen“, erklärt Bastian Swalve, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Wir müssen also jetzt handeln und können die Augen vor den Folgen des Klimawandels nicht verschließen!“ So äußert sich die Rats-SPD in einer Presseerklärung vom 27.10.25, in der sie ein „Maßnahmepaket für mehr Hitzeschutz in Braunschweiger Schulen“ vorstellt.
Den Elefant im Raum kann oder will sie (und für CDU und „Grüne“ gilt das nicht weniger) offenkundig aber nicht sehen. Wenn sie es nicht könnte, wäre Aufklärung, zu der ich mit meinem Artikel beitragen möchte, eine Hilfe. Eine gründliche Lektüre des „Klimaökologischen Gutachtens zum Planentwurf Bahnhofsquartier Braunschweig“ aus dem September 2024, das die Stadt bei der Firma GEO-NET in Auftrag gegeben hat (auf der Homepage der Stadt nachzulesen) könnte geschlossene Augen öffnen.
Wenn sie es nicht will, dann würde politischer Druck vielleicht helfen. Wie das gehen könnte, haben jüngst die Menschen in Berlin und Hamburg beispielhaft bewiesen. Der Berliner Senat hat auf Antrag der „Initiative Baumentscheid e.V.“ einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Stadt verpflichtet, bis 2040 für jeden gefällten Baum drei neue zu pflanzen. So und durch stadtweite erhebliche Neupflanzungen soll die gegenwärtige Zahl von 430.000 auf eine Million erhöht werden. Die Stadt übernahm den Gesetzentwurf der Initiative und vermied damit nicht nur einen Volksentscheid, sondern begab sich auf den Weg, die Stadt „hitzesicher und wetterfest“ zu machen. (https://www.baumentscheid.de)
Hamburg soll durch einen erfolgreichen Volksentscheid bis 2040 klimaneutral werden. Anders als in Braunschweig soll dies planbar und transparent mit jährlich abrechenbaren Zielen und sozialverträglich erfolgen. Auf Gutachten gestützt, sind diese Ziele ambitioniert, aber real finanzier- und erreichbar. Seit dem 12.10. ist Hamburg das einzige Bundesland, dessen Menschen sich ihr Klimaschutzgesetz selbst gegeben haben. Ein breites Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden hat mittels direkter Demokratie eine Verschärfung und Konkretisierung des Klimaschutzgesetzes erreicht und eine Mehrheit von 53% beim Volksentscheid hinter sich gebracht. (https://zukunftsentscheid-hamburg.de)
In Braunschweig hat sich der Verein „Bäume für Braunschweig“ gegründet. Getragen von der Erkenntnis, dass sehr viele Bäume die beste Vorsorge darstellen, die Folgen des Klimawandels auch in Braunschweig abzumildern, versucht er, die Lehren aus den Erfolgen in Berlin und Hamburg auch für Braunschweig zu nutzen. Er fordert für Braunschweig eine „Hitzeschutz-Satzung“ (https://bäume-bs.de). Solche Vorstellungen kann man/frau auch auf Ratsebene unterstützen (BIBS: „Bürgerinitiativen für Braunschweig“). Dort muss es auch sein, denn es ist die Spitze der Stadtverwaltung, die die Betonierung der Stadt vorantreibt und das städtische Eigentum an Straßen an „Investoren“ (BraWo und Konsorten) zum Bebauen verhökert.
Durch gemeinsames Engagement können wir etwas bewegen, auch wenn es oft mühsam ist. Aber da machen die Beispiele „Schrankenlösung Grünewaldstr.“ und „Rettung des Gliesmaroder Bades“ aus der jüngsten Vergangenheit Hoffnung.
Edgar Vögel