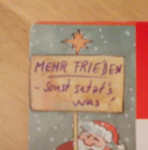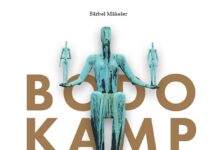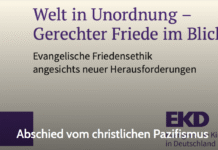Von Edgar Vögel
Die Pläne zur Umgestaltung des Bahnhofbereichs schreiten voran, die Folgen für das Lokalklima verschweigen die Planenden geflissentlich und über Geld wird schon gar nicht geredet: Beton statt Bäume!
Vorab, zur Klarstellung: Veränderungen mit dem Ziel der Verbesserung sind im Bahnhofsbereich grundsätzlich notwendig und sinnvoll, ja gar überfällig. Die folgenden Stichworte mögen genügen: untragbare Abstellsituation für Fahrräder, unterdimensionierter und unattraktiver (Fern-)Busbahnhof, funktionsloses Atrium-Bummelcenter, die Aufenthaltsqualität im unmittelbaren Bahnhofsbereich ist eher unattraktiv…
Die Stadt will jedoch eine grundsätzliche Umgestaltung auf den Weg bringen. In diesem Rahmen spielen obige Kritikpunkte eher eine Nebenrolle. Denn es geht dabei v.a. um Größeres, um Höheres, um das Entree einer urbanen europäischen Großstadt:
„Ziel der 155. Änderung des Flächennutzungsplans und des Bebauungsplanes mit örtlicher Bauvorschrift AW 118 ist die Entwicklung eines zukunftsfähigen Stadtquartiers nördlich des Braunschweiger Hauptbahnhofs. Durch den Rückbau überdimensionierter Verkehrsfläche soll ein Quartier mit ca. 600 Wohneinheiten, Geschäfts- und Bürogebäuden, öffentlichen Orten und Einrichtungen wie den Parks, grünen Straßenräumen und Plätzen sowie kulturellen und sozialen Angeboten entstehen. Ziel der Planung ist es auch, den Hauptbahnhof besser in die Stadt zu integrieren und ein urbanes Entree zur Innenstadt auszubilden.“
Immerhin sechs Jahre hat es vom Architektenwettbewerb bis zur Vorlage der beiden Pläne (s.o.) gedauert. Das verwundert bei näherer Betrachtung nicht.

Erstens: Das Problem mit der Überhitzung
Jährlich sterben im Schnitt der letzten Jahre allein in Deutschland 3.000 – 4.000 Menschen an Hitzefolgen. Die aktuellen Planungen blenden das Thema Überhitzung in der Praxis beim Bahnhofsquartier völlig aus – wider besseren Wissens. Die Umweltberatungsfirma GEO-NET aus Hannover, von der auch das aktuelle Klimagutachten für Braunschweig aus 2018 stammt, wurde beauftragt, die lokalklimatischen Folgen der Bauplanungen am Bahnhof zu begutachten. Schon 2018 wiesen die Gutachter auf ungünstige Entwicklungen hin und fanden offenkundig kein Gehör. Im neuen Gutachten wird überdeutlich betont und mit eindrucksvollen Grafiken untermauert, dass sich ein bereits jetzt be-stehender schlechter Zustand noch erheblich verschlechtern würde. Sollte nicht in letzter Sekunde ein völliges Umsteuern in der Klimapolitik erfolgen, so wird sich der gegenwärtige Hotspot Bahnhofsbereich bis 2050 mit Tagtemperaturen bis 45° und Nachttemperaturen nicht unter 22° (bei einer austauscharmen sommerlichen Hochdruckwetterlage) in eine No-go-Area verwandeln.
Zukunftsfähigkeit ist nicht gegeben
Damit ist die Zukunftsfähigkeit des gesamten Projekts nicht gegeben. Für den Anteil der globalen Erwärmung sind die Planer nicht verantwortlich. Wenn aber keine möglichen Gegenmaßnahmen ergriffen werden, sondern die Situation von ihnen sogar noch weiter zugespitzt wird, so sind sie für die Folgen wesentlich mitverantwortlich. Diesen zu begegnen hieße, viel, viel mehr Bäume zu pflanzen und die Bestehenden unbedingt zu erhalten. Es hieße, die Möglichkeit der Entsiegelung angesichts des Rückbaus überdimensionierter Straßen zu nutzen, statt sofort wieder neu zu versiegeln, noch dazu mit Betonklötzen, die halten, bis der Beton in 50+X Jahren bröselig wird. Und wer Überhitzung begegnen will, muss für Luftaustausch zu kühleren Orten wie Parks und Wasserflächen sorgen, wo immer es nur geht.
Machen die Planer aber nicht – im Gegenteil. Durch die Bebauung der Südecke von Viewegs Garten mit einem Dreierensemble aus 8, 6 und 5 Geschossen schneiden sie den Bahnhofsbereich weitgehend vom nächtlichen kühlenden Luftaustausch mit Viewegs Garten ab. Warum? Weil im Konzept dieser Riegel „eine unverzichtbare Portalfunktion“ habe. Mit fatalen Folgen, denn an einen erholsamen Schlaf ist im Hochsommer in den 600 Wohnungen ebenso wenig zu denken wie an die Arbeit am Tage in den zahlreichen Büros. Das setzt sich auch im westlichen Bahnhofsbereich fort, wo sich derzeit noch der Busbahnhof befindet.Mehrgeschossige Bebauung unterbindet auch dort künftig die Luftzufuhr von Süden weitgehend. Die Planenden wissen also, was sie tun. Was sie nicht zu wissen scheinen: Das Klima verhandelt nicht!
Keinerlei Konsequenzen aus dem Klimagutachten
Eifrig wird aus dem Klimagutachten zitiert, aber keinerlei Konsequenzen im Hinblick auf die zu erwartenden extremen Belastungen gezogen:
„Da die Planung eine räumliche Ausweitung der Gebäudestrukturen über bestehenden Verkehrsflächen und auch Grünflächen vorsieht, ist zu beobachten, dass sich sowohl in der Nacht- als auch in der Tagsituation ein Anstieg der Temperaturen, bzw. Wärmebelastung insbesondere im Bereich des Berliner Platzes, sowie an der Südspitze und Westspitze der Parkanlage Viewegs Garten durch den Verlust der Grünstrukturen bemerkbar macht. In diesen Bereichen ist durch weitläufig hohe Versiegelungsgrade und geringe Verschattung stellenweise mit extremen Wärmebelastungen an heißen Tagen zu rechnen.“ (Umweltbericht S. 18).
Ist aber nicht so schlimm, so die Planer, weil es dafür im Bereich der Kurt-Schumacher-Str. eventuell sogar etwas kühler wird. Und richtige Kaltluftschneisen könne man auch nicht unterbinden, weil es sie ja gar nicht gibt. Ein Freibrief, Luftaustausch ganz zu unterbinden?
Stattdessen wird versucht, der Kritik von GEO-NET das Argument entgegen zu setzen, die Planungen seien insgesamt sehr klimafreundlich. Es wird – quasi ersatzweise – insbesondere auf die CO2-Reduzierung verwiesen; durch kurze Wege und keine zusätzliche Versiegelung beim Bauen auf bereits verdichtetem Untergrund. Auf vielfältige und nachdrückliche Kritik der Öffentlichkeit hin wurde der grüne Aspekt verstärkt: Fassaden- und Dachbegrünung, Pocket-Parks, Versickerung von Regenwasser vor Ort, geringfügige Reduzierung des Baukörpers an der Südecke von Viewegs Garten, was jetzt wieder einen Gucklochblick vom Bahnhof in den Park ermögliche, wie lächerlich!
Keine CO2-Bilanz ohne Gegenrechnung
Man kann durchaus positiv auf die CO2-Reduzierung verweisen, muss sich dann aber der Gegenrechnung stellen. Die Herstellung von Beton, also im Wesentlichen die von Zement, gehört zu den energieaufwendigsten und am meisten CO2 freisetzenden industriellen technischen Prozessen überhaupt. Die Frage, wie viele Zehntausend Tonnen Beton für die Errichtung der hohen Gebäude hergestellt werden müssten und wieviel Energie (sogenannte „graue Energie“) dafür benötigt werde, blieb bislang unbeantwortet. Für die Herstellung von 1 m³ Beton werden 2.775 MJ Energie benötigt. Die Zementindustrie in Deutschland ist für 10% der industriellen CO2-Emissionen verantwortlich.
Nicht alle städtischen Abteilungen sind mit den Planungen richtig glücklich. Kritik gibt es von „Stadtgrün“ im persönlichen Gespräch. Deutlicher sind die Äußerungen aus dem Fachbereich Umwelt. Hier wird in der Stellungnahme die Frage aufgeworfen, ob und inwieweit die Planungen mit den gesetzlichen Verpflichtungen zur Klimafolgenanpassung vereinbar seien. Das steht im Einklang mit Bemühungen im Fachbereich, der Klimafolgenanpassung mehr Gewicht zu verleihen und die Bürger einzubeziehen: siehe das Projekt „COABS“.
Die bisherige öffentliche Kritik manifestierte sich deutlich in mehreren „Beteiligungsformaten“, in denen von den Organisatoren viel Mühe verwendet wurde, mit Hilfe von externen Moderatoren die Kritik zu kanalisieren und zu relativieren. Dies Formate seien nicht immer „glücklich“ verlaufen, räumen die Planenden jetzt auch ein. So kann man es auch nennen.

Zweitens: Das Problem mit den Bäumen
In der Ausschreibung für den Architekturwettbewerb 2019 stand noch: „Insgesamt 377 Bäume diverser Arten befinden sich im Wettbewerbsgebiet. Davon sind circa 75% in der Adult-/ Reifephase, in der sich der Baum vor allem entsprechend seines Standortes und derArt ausdehnt. (Wachstumsphase – Alter zw. 15 und 50 Jahre).
Die aktuelle Grünbilanz im Wettbewerbsgebiet ist mindestens zu erhalten. Hier ist nicht nur die reine Flächenbilanz ist (so im Original) zu betrachten, sondern auch die Biomasse/ Grünsubstanz in Form der 377 Bäume ist zu erhalten.“ (Auslobung, S.31) Davon ist inzwischen nicht mehr die Rede und die Preisträger haben sich auch nicht daran halten müssen. Laut Umweltbericht sind es nunmehr „knapp 300 Bäume“, von denen rund200 gefällt und lediglich 250 nachgepflanzt werden sollen.
Umfang der Nachpflanzungen für gefällte Bäume: völlig unakzeptabel
Das ist wirklich lächerlich, wenn es um die Erhaltung der Biomasse ginge, müssten es mehr als 600 sein. Neupflanzungen ersetzen den Verlust ohnehin erst nach mehreren Jahrzehnten. Zudem gibt es keinerlei Zusicherung, dass alle Neuanpflanzungen im Planungsgebiet stattfinden sollen. Angesichts der Planungen wäre schon für 250 neue gar nicht genug Platz. Passt irgendwie zur Denke im Umkreis des Baudezernats. In Brauschweig gingen von 2019–2024 40 Hektar Bäume verloren. In den Wettbewerbsbedingungen war zu lesen: “ DieParkanlage Viewegs Garten soll erhalten bleiben, d.h. den Park begrenzende Bebauungen dürfen ausschließlich außerhalb des noch erhaltenen Parkbereichs erfolgen.“ Auch davon hat man sich inzwischen verabschiedet, auch wenn noch immer das Gegenteil behauptet wird. In der Nordwestecke liegt der Neubau eines Kindergartens auf Parkgelände, an der Südecke gar eine Straße, die die anliegenden Gebäude (8, 6 und 5 Geschosse) erschließt.
Bäume in der Stadt sind das A und O, dem Klimawandel zu begegnen und einer Überhitzung der Innenstädte Paroli zu bieten. Sie ermöglichen erst einen längeren Aufenthalt im Freien in der Innenstadt. Dieses Faktum ist unstrittig und wissenschaftlicher Standard. Er gilt vielleicht irgendwann auch in Braunschweig, der Stadt der Wissenschaft und dann hoffentlich nicht zu spät.
Beton statt Bäume / Teil zwei folgt